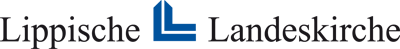Religionen im Gespräch
Dr. Amir Dziri: Gott muss transzendent bleiben
Dr. Dziri, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Islamische Theologie der Universität Münster, war auf Einladung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe und der Evangelischen Studierenden Gemeinde Detmold/Lemgo ins Haus Münsterberg gekommen. Er eröffnete seinen Vortrag mit der These: „Nicht nur in der weiten Öffentlichkeit, sondern auch in Fachkreisen herrscht die Vorstellung vor, dass der Islam, wie das Judentum und in abgeschwächter Form das Christentum, ein rigoroses Bilderverbot propagiere“. Der Begriff „Bilderverbot“ sei zu „unpräzise“, so Dr. Dziri und zeigte im Laufe des Abends auf, wie gesellschaftliche Zusammenhänge oder historische „Weggabelungen“ Einfluss genommen haben.
Ein Anliegen seines Vortrages war es, die gemeinsamen Wurzeln des Judentums, des Christentums und des Islam in dieser Frage aufzuzeigen. Im Judentum greife ein Bilderverbot erst, „wenn etwas kultfähig ist“, erklärte der Referent. Nur das, was man wie einen Gott behandle, sei verboten, was man aber nicht wie einen Gott behandle, sei erlaubt. Dr. Amir Dziri belegte diese Erkenntnis mit zahlreichen Textzitaten und stellte dann fest, dass man die Diskussion um Bilder auch 1:1 im Christentum wiederfinde. Im byzantinischen Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert, der zwischen Kirchenvertretern in Rom und in Konstantinopel geführt wurde, setzten sich dann allerdings die Bilderbefürworter der westlichen Kirche durch. Da Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, spräche auch nichts dagegen, Jesus und Geschichten der Bibel bildlich darzustellen. Auch bete man die Ikonen nicht als Götzenbilder an. Außerdem würden die Bilder den Menschen helfen, die Botschaft besser zu verstehen – so die Argumente der Bilderbefürworter. Dies habe – so Dziri – dazu geführt, dass sich der christliche Weg, Bilder im Gottesdienst zu nutzen, als Sonderweg gegenüber dem Judentum und dem Islam entwickelte.
Für den Islam gelte Ähnliches wie im Judentum. Die historische Umsetzung des Bilderverbots sei in den Jahren 661-750 geschehen, so der Referent. Charakteristisch für den Islam bzw. für muslimische Gesellschaften sei es, dass sich im öffentlichen Raum die Bilderlosigkeit durchsetzte, die ihren Ausdruck in der Architektur, Kalligrafie und Ornametik findet. Im privaten Raum hingegen, z.B. im Leben am Sultanshof oder in den Privathäusern, waren Bilder erlaubt und präsentierten den besonderen Status des Besitzers der Bilder.
Schließlich ordnete Dr. Amir Dziri das Bilderverbot aus heutiger Sicht ein. Die Bildsprache könne verständlich machen und Gegenwärtigkeit erzeugen, dürfe theologisch aber „keine Vorstellung der unmittelbaren Greifbarkeit vermitteln: Gott muss transzendent bleiben“, stellte er fest. Gesellschaftlich begegne uns „in jeder Sekunde eine Bilderflut“. Seine Schlussthese: „Die Frage nach der Wirkung von Bildern auf unser Bewusstsein wird öffentlich nicht in der Intensität thematisiert, wie wir davon betroffen sind“.
05.10.2015